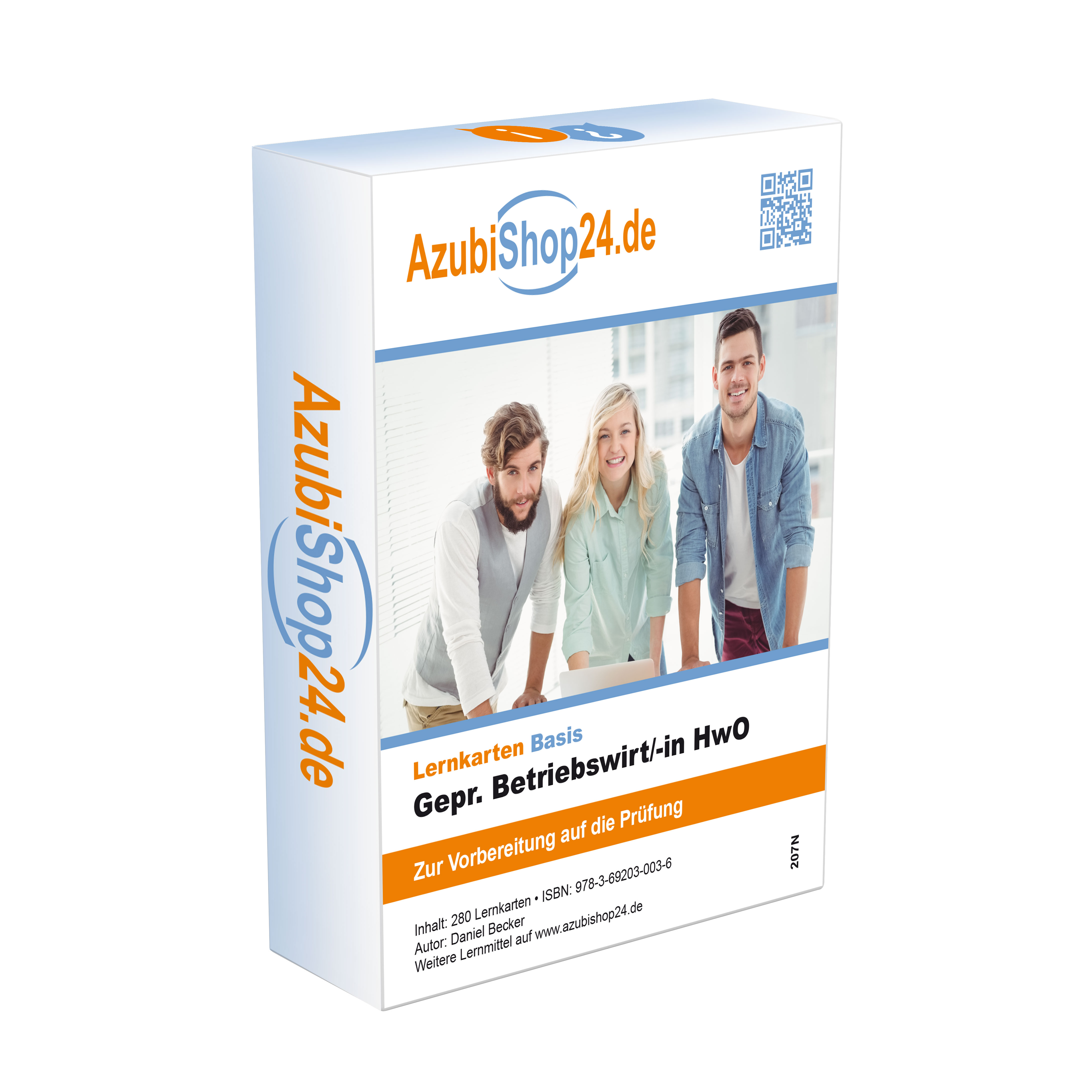280 Gepr. Betriebswirt HwO Lernkarten
Fichier Détails
| Cartes-fiches | 280 |
|---|---|
| Langue | Deutsch |
| Catégorie | Matières relative au métier |
| Niveau | Apprentissage |
| Copyright | AzubiShop24.de |
| Crée / Actualisé | 15.10.2025 / 15.10.2025 |
| Imprimable | Non |
Extrait
Tu vois un extrait de ce fichier. Nous te prions de prendre contact avec nous pour recevoir accès à ce fichier.
Was beschreibt der Begriff „Bedürfnis“
in der Volkswirtschaftslehre?
In der Volkswirtschaftslehre gilt ein Bedürfnis als der Wunsch,
einen Mangelzustand zu beseitigen. Es handelt sich um den
Ausgangspunkt wirtschaftlichen Handelns, denn aus Bedürfnissen
entstehen Bedarf und letztlich Nachfrage am Markt.
Ein Handwerksbetrieb stellt fest, dass Kunden in letzter Zeit verstärkt nach nachhaltigen Produkten fragen.
Wie lässt sich dieses Verhalten volkswirtschaftlich einordnen?
Dieses Verhalten deutet auf veränderte Konsumentenbedürfnisse
hin, die zu einem neuen Bedarf führen. Dieser Bedarf wird durch
Kaufentscheidungen zur Nachfrage, was wiederum Auswirkungen
auf Produktion und Angebot hat.
Was unterscheidet freie von wirtschaftlichen Gütern?
Freie Güter sind in unbegrenzter Menge verfügbar und haben
keinen Preis (z. B. Luft), während wirtschaftliche Güter knapp und
damit preisrelevant sind. Wirtschaftliches Handeln beschäftigt sich
ausschließlich mit dem Umgang mit solchen knappen Ressourcen.
Ein Unternehmen versucht, aus vorhandenem Lagerbestand möglichst viele Aufträge zu erfüllen.
Welches Prinzip des wirtschaftlichen Handelns
liegt hier zugrunde?
Es handelt sich um das Maximalprinzip: Mit begrenzten Mitteln
(Lagerbestand) soll ein maximaler Nutzen (Auftragsabwicklung) erzielt
werden – eine klassische Ausprägung des ökonomischen Prinzips.
Wie wird das Minimalprinzip definiert?
Beim Minimalprinzip soll ein festgelegtes Ziel mit dem geringstmöglichen
Einsatz von Ressourcen erreicht werden. Es gehört
zum ökonomischen Prinzip, das rationales wirtschaftliches
Handeln beschreibt.
Ein Unternehmen will eine bestimmte Produktionsmenge mit möglichst wenig Energie und Rohstoffen herstellen.
Welcher ökonomische Ansatz wird hier verfolgt?
In diesem Beispiel wird das Minimalprinzip angewendet. Das
Unternehmen strebt an, ein konkretes Ziel (Produktionsmenge) mit
möglichst geringem Mitteleinsatz zu erreichen – ein typisches Ziel
wirtschaftlicher Effizienz.
Was versteht man unter dem Begriff „Wirtschaften“?
Wirtschaften beschreibt das planvolle Handeln zur Befriedigung
menschlicher Bedürfnisse mit knappen Gütern. Es ist die Grundlage
aller wirtschaftlichen Prozesse und beruht auf dem Prinzip der
Rationalität und Nutzenmaximierung.
Ein Handwerksunternehmen muss sich zwischen zwei
Investitionen entscheiden, da das Budget nur eine
Maßnahme zulässt.
Welche volkswirtschaftliche Grundproblematik zeigt sich hier?
Dieses Beispiel verdeutlicht das ökonomische Grundproblem der
Knappheit. Weil Ressourcen begrenzt sind, müssen Entscheidungen
getroffen werden, wie sie am nutzenbringendsten eingesetzt
werden können.
Wie entsteht der Gleichgewichtspreis in einer Marktwirtschaft?
Der Gleichgewichtspreis ergibt sich an dem Punkt, an dem sich Angebot
und Nachfrage auf dem Markt treffen. Er stellt sicher, dass genau
die Menge eines Gutes angeboten wird, die auch nachgefragt wird.
Ein Produkt ist sehr gefragt, doch die Anbieter erhöhen
wegen Materialmangels kaum die Menge.
Welche Folge zeigt sich auf dem Markt?
In dieser Situation entsteht eine Knappheit, wodurch der Preis
steigt. Dieses Marktverhalten folgt dem Prinzip, dass eine hohe
Nachfrage bei geringem Angebot zu einem Preisanstieg führt.