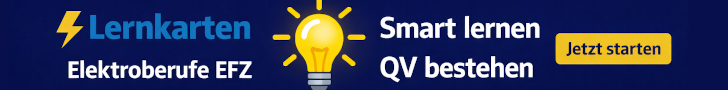WOT
Werkstoff und Oberflächentechnik
Werkstoff und Oberflächentechnik
80
5.0 (1)
Thore Brodersen
Thore Brodersen
Kartei Details
| Zusammenfassung | Diese Karteikarten behandeln fortgeschrittene Themen der Werkstofftechnik auf Universitätsniveau, mit einem Schwerpunkt auf Stahl, dessen Eigenschaften, Verarbeitung und Prüfverfahren. Sie erläutern verschiedene Wärmebehandlungsmethoden wie Nitrieren, Einsatzhärten und Randschichthärten, sowie deren Anwendungen und Vorteile. Die Karteikarten sind besonders nützlich für Studierende und Fachleute, die sich mit der Materialwissenschaft und Ingenieurwesen beschäftigen, da sie detaillierte Kenntnisse über Werkstoffe und deren Behandlung vermitteln. |
|---|---|
| Karten | 80 |
| Lernende | 3 |
| Sprache | Deutsch |
| Kategorie | Technik |
| Stufe | Universität |
| Erstellt / Aktualisiert | 03.01.2015 / 23.06.2023 |
| Weblink |
https://card2brain.ch/cards/wot
|
| Einbinden |
<iframe src="https://card2brain.ch/box/wot/embed" width="780" height="150" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
|
-
1.8 Skizzieren Sie in einem schematischen Gefügebild die Korrosionsart "transkristalline Spannungsrisskorrosion". Welche Voraussetzungen müssen vorliegen, damit tk SpRK auftreten kann? Nennen Sie 2 Werkstoff/Medium-Kombinationen, bei denen mit SpRK gerechnet werden muss. Worin besteht die besondere Gefährlichkeit der SpRK?
-
1.22 Wasist"Chromatieren"?Warummachtmandas?
Gelb-, Grün-, Oliv- und Schwarzchromatierung z. B. bei Schrauben. Chrom(VI)- Problematik.
1.22